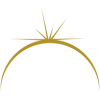Mittwoch, 17. September 2025 von Corinna Harder & Oliver Harder
Mittwoch, 17. September 2025 von Corinna Harder & Oliver Harder
Folge 1
Zwischen den Jahren: Wo alles beginnt
Vielleicht spürst du es auch, ohne sofort sagen zu können, weshalb: Die längsten Nächte des Jahres tragen eine besondere Stimmung. Das alte Jahr ist noch nicht vorbei, aber auch nicht mehr ganz gegenwärtig. Dunkelheit verlangsamt den Alltag, macht uns empfänglicher und feinsinniger. Genau diese »Zwischenzeit« nehmen Menschen seit Jahrhunderten als besonders wahr – als Phase, in der der gewohnte Rhythmus unterbrochen ist und sich ein Raum für Rückschau, Reinigung und Neuausrichtung öffnet. Im gedämpften Licht einer Kerze fällt es leichter, nach innen zu lauschen und tiefer zu blicken ...
Es sind die sagenumwobenen Rauhnächte – zwölf Tage und Nächte nach der Wintersonnenwende. Sie bilden den Rahmen für das 13-Wünsche-Ritual, das in den vergangenen Jahren stetig an Beliebtheit gewonnen hat – und auch den Namen unserer Facebook-Gruppe inspiriert: 12 Rauhnächte – 13 Wünsche.
Die Kelten als »Erfinder« der Rauhnächte
Ihren Ursprung haben die Rauhnächte in einer Zeit, in der sich die Menschen eng mit dem Rhythmus von Natur, Tod und Geburt, Werden und Vergehen verbunden fühlten.
Häufig wird berichtet, die Wurzeln der Rauhnächte lägen in der keltischen Jahreseinteilung. Es heißt, die 12 Rauhnächte sollten den Unterschied zwischen dem Mondjahr (354 Tage) und dem Sonnenjahr (365 Tage) ausgleichen. Als Rechenbasis dient die Differenz von rund 11 Tagen → symbolisch umgedeutet in 12 Nächte. Das klingt zwar plausibel und ist narrativ attraktiv, lässt sich aber nicht belegen. Dennoch liebt Social Media diese Geschichte und verbreitet sie munter weiter ... Was tatsächlich bekannt ist: Die Kelten nutzten einen lunisolaren Kalender, wie der Kalender von Coligny aus gallo-römischer Zeit zeigt.
Historisch fassbar werden die Rauhnächte erst im mittelalterlich-christlichen Kontext, wo sich ältere winterliche Bräuche mit kirchlichen Festzyklen vermischen – ein synkretistisches Geflecht, in dem keltische Elemente zwar mitschwingen könnten, jedoch nicht eindeutig nachweisbar sind.
Die ältesten Belege zu den Rauhnächten stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Damals erschienen die ersten gedruckten Berichte, die von den »zwölf Nächten« zwischen Weihnachten und Dreikönig erzählen. So beschreibt der Gelehrte Johannes Boemus 1520 in seinem Buch Omnium Gentium Mores, dass in diesen Nächten Haus und Stall mit Rauch gereinigt wurden, um böse Geister fernzuhalten. Einige Jahre später berichtet Sebastian Franck in seiner Chronica (1534) von ähnlichen Bräuchen und nennt ebenfalls die Zeit zwischen Weihnachten und Epiphanias. Auch kirchliche Akten aus dem 16. und 17. Jahrhundert erwähnen Verbote, Orakel und Schutzrituale während dieser Nächte. Diese Texte gelten als die ersten gesicherten Aufzeichnungen für den Brauch der Rauhnächte.
Grimm und die romantische Mythenforschung
Ab dem 19. Jahrhundert gewannen keltische und germanische Deutungen enorme Popularität. Die romantische Altertums- und Mythenforschung – etwa Jacob Grimms Werk Deutsche Mythologie (1835) – sammelte und systematisierte regionale Bräuche, verband sie mit alten Götterwelten und prägte so das Bild der Rauhnächte, das bis heute nachwirkt. Getragen wurde dieses Interesse von einer Epoche, die in der Industrialisierung und den politischen Umbrüchen nach nationaler Identität und mythischen Ursprüngen suchte.
Die moderne Volkskunde ist hier allerdings zurückhaltender: Konkrete, durchgehende Linien von vorchristlichen Festen direkt auf die heutigen Rauhnachtspraktiken gelten als unsicher. Vieles spricht eher für Überlagerungen, Anpassungen und Umdeutungen innerhalb christlicher Festzeiten und lokaler Kalenderpraxis.
Zeit jenseits der Beweise
Doch auch wenn die historischen Spuren verschwimmen, bleibt die Erfahrung dieser Tage spürbar. Volkskundliche Forschungen zeigen, dass die »zwölf heiligen Nächte« kein einheitliches Dogma kennen, sondern ein vielschichtiges Übergangsritual darstellen. Mondkalender und Sonnenjahr, christliche Liturgie und bäuerlicher Jahreslauf haben sich hier über Jahrhunderte verflochten. Eben diese Mischung aus astronomischem Maß, religiöser Symbolik und praktischer Lebensordnung macht den besonderen Reiz der Rauhnächte aus: Sie öffnen einen Raum, in dem sich Zeit und Bedeutung überlagern – und geben dir zugleich die Freiheit, eigene Deutungen und Rituale zu gestalten.
Gerade weil die historischen Linien unscharf sind, liegt die eigentliche Kraft der Zwölften in ihrer Struktur. Zwölf ist eine Zahl der Vollendung: Zwölf Monate strukturieren unser Jahr, zwölf Tierkreiszeichen den Himmel, selbst unsere Zeitrechnung teilt den Tag in zwei mal zwölf Stunden. Wenn du die Zwölften bewusst begehst, trittst du in diesen Kreis der Ordnung ein und schenkst dem vergangenen Jahr einen klaren symbolischen Abschluss.
Dein erster Funke
Jede der 12 Rauhnächte lädt dich ein, Bilanz zu ziehen: Was hat sich bewährt? Was darf gehen? Was möchte neu wachsen?
Nimm dir ein paar Minuten und notiere in deinem Rauhnachtsjournal drei kurze Sätze:
Was fasziniert mich an den Zwölften – Geschichte, Atmosphäre, Stille?
Welche Qualität möchte ich in dieser Zeit erleben – Rückzug, Klarheit, Freude, Mut?
Was erhoffe ich mir von den 13 Wünschen – Orientierung, Veränderung, Bestätigung?
Diese drei Sätze sind dein erster Funke. Du musst nichts weiter tun, als sie aufzuschreiben. Alles Weitere – die Vorbereitung deines Platzes, das Schreiben der Wünsche, die ersten Nächte – wird sich darauf aufbauen.
In den kommenden Folgen begleiten wir dich durch das 13-Wünsche-Ritual. Du wirst erfahren, wie du 13 Herzenswünsche formulierst, warum das tägliche Verbrennen so kraftvoll ist, welche psychologischen Mechanismen hinter dem scheinbar Magischen stecken und weshalb der letzte, der 13. Wunsch, eine ganz eigene Rolle spielt. Heute aber reicht es, diesen besonderen Zwischenraum bewusst wahrzunehmen. Jeder große Wandel beginnt mit einem Moment der Stille – und vielleicht mit dem ersten Satz in deinem Journal.
Weiterlesen
Zurück zur Startseite